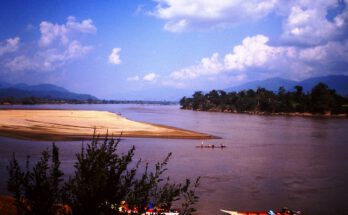Wie hält man eine ganze Hauptstadt politisch in Atem, ohne ein Amt zu bekleiden und ohne je gewählt worden zu sein? Im Juni 1963 kommentiert die in Saigon allgegenwärtige Madame Nhu sarkastisch die Selbstverbrennung buddhistischer Mönche. Sie spricht von einem „barbecue“ und erklärt, sie sei bereit, „Brennstoff und Streichhölzer zu liefern“. Ein Satz, der um die Welt geht.
Herkunft und frühe Prägungen

Trần Lệ Xuân kommt 1924 in Hanoi zur Welt, als Kind einer einflussreichen Familie zwischen Kaiserhof, französischer Kolonialverwaltung und moderner Bildung. Zu Hause spricht man Französisch. In der Schule lernt sie mehr über die Loire als über den Roten Fluss. Diese Entfremdung von einer eigenen vietnamesischen Geschichte wird sie später selbst benennen. Musik, Ballett und eine sprunghafte Energie prägen die junge Frau.
Mit achtzehn heiratet sie Ngô Đình Nhu, den intellektuellen Strategen der politisch ambitionierten Ngô-Familie. Sie konvertiert zum Katholizismus. Der Ehemann baut die Kaderpartei Cần Lao auf, ideologisch gespeist aus dem Personalismus, einer katholisch geprägten Lehre, die den „Menschen als Person“ in Gemeinschaft betont. Während in Vietnam Krieg, Neuordnung und Machtkämpfe die Landschaft verändern, zieht die junge Frau in Đà Lạt Kinder groß und wartet oft auf einen Mann, der selten zu Hause ist.
Aufstieg an die Seite eines Junggesellen
1955 erklärt Präsident Ngô Đình Diệm den Staat zur Republik. Da er unverheiratet bleibt, tritt Madame Nhu als Schwägerin in die Rolle der Ersten Dame. Sie sucht das Rampenlicht und baut Netzwerke auf. Ihre Handschrift wird im Recht sichtbar.
Politik mit zwei Gesichtern

1957 bringt sie ein Familiengesetz ins Parlament, das 1958 verabschiedet wird. Es stärkt Erbrechte von Töchtern, erleichtert Frauen den Zugang zu Konten und Eigentum und verbietet Polygamie sowie Konkubinat. Für die patriarchal geprägte Gesellschaft ist das ein Einschnitt. Gleichzeitig treibt sie Moralgesetze voran. Tanzlokale, Wettkämpfe mit Tieren, Prostitution und Opiumhöhlen werden geschlossen. Abtreibung, Scheidung und Verhütung stehen unter Strafe. Der Staat beansprucht Tugend zu erzwingen, während die Familie Luxus lebt und Affären im Umlauf sind.
Nach den Eingriffen ins Familien- und Moralrecht suchte sie nach Symbolen für eine größere Öffentlichkeit. Madame Nhu gründet die Frauen Solidaritätsbewegung. Offiziell sollen Frauen für den Kampf gegen den Vietcong mobilisiert werden, praktisch bindet die Organisation Loyalität an die Familie. In Saigon lässt sie ein Monument für die Trưng Schwestern errichten, die im ersten Jahrhundert gegen China aufstanden. Die Gesichter ähneln ihrem eigenen. Nationalmythos wird zur Selbstinszenierung.
Die buddhistische Krise

1963 eskaliert der Konflikt zwischen einem katholisch geprägten Regime und der buddhistischen Mehrheit. Der Streit um Flaggen, Umzüge und Feiertage wird zum Katalysator, weil dahinter Erfahrungen von Benachteiligung stehen. Als sich Mönche anzünden, reagiert Madame Nhu mit Zynismus. Ihre Worte treffen die Öffentlichkeit und entfremden die amerikanischen Verbündeten. Diplomaten fordern die Präsidentenfamilie auf, sie zum Schweigen zu bringen. Der Palast kann oder will es nicht. Proteste weiten sich aus. Pagoden werden gestürmt, es gibt Tote und Verletzte.
Reise in die Vereinigten Staaten

Als die Proteste eskalierten und internationale Kritik zunahm, entschied sich die Regierung, sie auf eine Reise zu schicken. Im Herbst 1963 reist Madame Nhu nach Europa und in die USA, um das Regime zu verteidigen. Sie attackiert Kritiker, bezeichnet Amerikaner als zu weich gegenüber dem Kommunismus und liefert provokante Schlagzeilen. Ihr Vater, Botschafter in Washington, wendet sich öffentlich gegen sie und legt sein Amt nieder. Die Tour, als Triumph geplant, wird zur medienwirksamen Selbstentlarvung. Während sie spricht, bröckelt in Saigon die Machtbasis der Familie.
Putsch und Verlust
Am 2. November 1963 werden Präsident Diệm und Ngô Đình Nhu von Offizieren der eigenen Armee getötet. Madame Nhu befindet sich in Kalifornien und macht die Vereinigten Staaten für den Sturz verantwortlich. Mit dem Tod von Diệm und Nhu war ihre politische Bühne verschwunden. Ihre Kinder kommen über Rom in Sicherheit. Die neue Militärführung enteignet den Besitz der Familie. Die Statuen der Trưng Schwestern werden demoliert. Vietnam steuert auf einen immer umfassenderen Krieg zu.
Exil und Nachhall
Es folgte das lange Leben im Exil. Madame Nhu verbringt die Jahre in Rom und später in Frankreich und Italien. Eine Tochter stirbt bei einem Autounfall, der jüngere Bruder wird in den USA wegen des Mordes an den Eltern angeklagt. Interviews gibt sie nur selten, ihre angekündigten Memoiren erscheinen nie. 2011 stirbt sie in Rom.
Wahrnehmung in den Medien
Zeitgenössische deutsche und amerikanische Berichte sahen in ihr eine Projektionsfläche. Magazine wie der „Spiegel“ schilderten, wie sie persönlich Telefonate mit Redaktionen führte und Einfluss auf die Berichterstattung nahm. In westlichen Medien wurde sie häufig als „Dragon Lady“ bezeichnet, ein kolonial geprägtes Klischee, das asiatische Frauen mit Verführung und Intrige gleichsetzte. Artikel inszenierten sie wie eine Figur aus einem Spionagethriller. Ihre Bereitschaft, sogar über einen Frieden mit den Kommunisten nachzudenken, verstärkte das Bild einer undurchsichtigen Frau an der Schaltstelle der Macht.
Versuch einer Einordnung
Die Figur lässt sich weder als Karikatur der „Drachenlady“ abtun noch zur frühen Feministin verklären. Sie verband rechtliche Schritte zugunsten von Frauen mit einem autoritären Moralprogramm. Sie mobilisierte Frauen öffentlich und hielt doch die politischen Zügel in einem engen Familienzirkel. Ihre Schlagfertigkeit bot klare Kante, beschädigte aber die eigene Sache, weil sie den Ton der Krise verschärfte. In ihrer Person kreuzten sich Kolonialprägung, katholische Elitenbildung, Familienherrschaft und die Logik eines Kalten Krieges, der Bündnisse nach Feindlagen sortierte.

Zum Weiterlesen
Links mit Sternchen (*) führen zu Amazon.de. Einkäufe dort unterstützen unsere Arbeit ohne Mehrkosten.
Monique Brinson Demery (2014): Finding The Dragon Lady: The Mystery of Vietnam’s Madame Nhu.*
Bildnachweis
Titel: Familienfoto zur Konfirmation der Tochter von Madame Nhu (ganz rechts) und Ngo Dinh Nhu (ganz links).
Alles gemeinfrei.