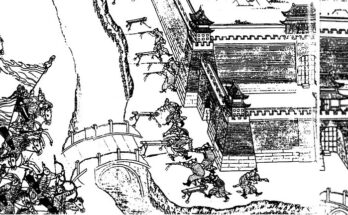Politische Herkunft einer Kulturthese
In den 1990er Jahren etablierten mehrere asiatische Staatsführer eine These, die rasch internationale Aufmerksamkeit erhielt: Die Menschenrechte, wie sie in westlichen Demokratien verstanden werden, seien nicht ohne Weiteres auf Asien übertragbar. Singapurs Premier Lee Kuan Yew und Malaysias Langzeit-Regierungschef Mahathir Mohamad sprachen von einem eigenen System „asiatischer Werte“. Es sei stärker auf Ordnung, Disziplin, kollektive Verantwortung und Respekt vor Autorität ausgerichtet – im Gegensatz zur westlichen Betonung individueller Freiheit und persönlicher Autonomie.
Diese Position diente einer doppelten Funktion: Sie war Reaktion auf internationale Menschenrechtskritik und zugleich Ausdruck eines neuen politischen Selbstbewusstseins. Der wirtschaftliche Aufstieg Ost- und Südostasiens schien ein Gegenmodell zum westlichen Liberalismus zu legitimieren.
Amartya Sen: Kultur als Argument, nicht als Erklärung

Der indische Nobelpreisträger Amartya Sen kritisierte diese Rhetorik entschieden. In seinem vielzitierten Essay „Human Rights and Asian Values“ (1997) entlarvte er den Rückgriff auf vermeintlich „asiatische“ Traditionen als politisches Instrument. „Das Konzept asiatischer Werte ist weder ein analytischer noch ein historischer Begriff“, schrieb Sen, „es ist ein politischer Konstruktionsversuch, um unliebsame Normen abzuwehren.“
Sen verweist darauf, dass Freiheit, Gerechtigkeit und Verantwortlichkeit keine westlichen Erfindungen seien. Die indische Antike, chinesische Philosophie und islamische Rechtskultur enthielten seit Jahrhunderten Konzepte individueller Würde und moralischer Autonomie. Konfuzianismus etwa betone zwar die Rolle der Gemeinschaft, aber auch die Verpflichtung der Herrschenden zur Tugend. Autoritäre Regierungen, so Sen, dürften sich nicht auf kulturelle Wurzeln berufen, die sie in ihrer Praxis selbst verletzen.
Keine Einheit: Der Mythos vom „asiatischen Konsens“

Sen kritisiert zudem, dass die asiatischen Werte suggerieren, es gebe eine homogene asiatische Kultur. Das sei empirisch nicht haltbar. Die kulturelle, sprachliche und religiöse Vielfalt Asiens sei immens. Wie könne es da einheitliche Werte geben?
Zudem sei der Widerstand gegen autoritäre Regierungen keineswegs nur westlich motiviert. Demokratiebewegungen in Südkorea, auf den Philippinen, in Indonesien oder in Myanmar beriefen sich explizit auf nationale Traditionen, nicht auf importierte Ideale. Viele asiatische Intellektuelle, darunter auch liberale Konfuzianer wie Tu Weiming, widersprachen der These, individuelle Rechte seien kulturell „unasiatisch“.
Menschenrechte sind nicht identisch mit westlichen Praktiken
Ein weiterer Kernpunkt in Sens Argumentation ist die Unterscheidung zwischen Menschenrechten als moralischer Idee und den konkreten Ausformungen westlicher Staaten. Dass liberale Demokratien eigene Probleme mit Rassismus, Ungleichheit und Polizeigewalt haben, sei unbestreitbar – doch das diskreditiere nicht den Anspruch auf universelle Rechte. Im Gegenteil: Gerade weil kein Land vollkommen sei, müsse der Anspruch auf Würde und Freiheit global verankert werden.
Sen argumentiert für einen „dialogischen Universalismus“: Die Grundidee der Menschenrechte sei nicht westlich, sondern weltweit anschlussfähig – gerade weil sie auf eine minimal gemeinsame Ethik abziele, nicht auf ein vollständiges Wertesystem.
Die Debatte als Spiegel der Machtverhältnisse

Die Rhetorik der asiatischen Werte sollte deshalb nicht romantisiert werden. Sie entstand nicht aus kulturphilosophischer Reflexion, sondern als politische Reaktion auf Druck. Mahathir Mohamad etwa äußerte sich zur Pressefreiheit nur dann zustimmend, wenn sie mit nationaler Stabilität vereinbar sei. Lee Kuan Yew rechtfertigte umfassende staatliche Kontrolle mit dem Argument, dass Asien „nicht bereit“ für westliche Freiheiten sei – eine Behauptung, die auch Kolonialherren einst nutzten.
Sen sieht darin eine „paternalistische Umkehr“: Die politische Führung spricht im Namen kultureller Werte, um ihre eigene Autorität zu festigen. Dabei wird die Gesellschaft auf ein homogenes Wesen reduziert – und ihre internen Konflikte ignoriert.
Fazit: Für einen echten kulturellen Dialog
Die Debatte um asiatische Werte hat wichtige Fragen aufgeworfen: Wie universell sind Menschenrechte? Wie viel kulturelle Eigenheit ist zulässig? Wie kann man koloniale Dominanz überwinden, ohne moralischen Relativismus zu fördern?
Amartya Sen bietet darauf eine klare Antwort: Kulturelle Unterschiede dürfen nicht zum Vorwand werden, um grundlegende Freiheiten auszuhebeln. Menschenrechte entstehen nicht aus einem westlichen Monopol, sondern aus geteilten moralischen Erfahrungen – auch in Asien. Der Weg zu ihrer Umsetzung mag verschieden sein. Doch ihr Anspruch gilt überall.
Mehr erfahren
Links, die mit Sternchen (*) gekennzeichnet sind, führen auf die Seite von Amazon.de. Wenn Sie über diese Links bestellen, unterstützen Sie unsere Arbeit, ohne dass Ihnen Mehrkosten entstehen.
- Christian Neuhäuser (2025) – Amartya Sen zur Einführung *
- Tu Weiming (1997): Confucianism and Human Rights – differenzierte Vermittlung zwischen Ost und West *
- Amartya Sen (1997) – Human Rights and Asian Values – frei online zugänglich
Bildnachweis
Titel: Lee Kuan Yew trifft den amerikanischen Verteidigungsminister Cohen, 2000.
Sen: Wikimedia Commons, Fronteiras do Pensamento.
Mahathir: Wikimedia Commons, XTLOH.
Alles Weitere gemeinfrei.