Ein Ort der Versammlung
Am 13. April 1919 versammelten sich nach Schätzungen bis zu 25.000 Menschen im Jallianwala Bagh, einem ummauerten Gelände nahe dem Goldenen Tempel von Amritsar. Viele waren aus Anlass des Baisakhi-Fests gekommen, andere aus Protest gegen die Repressionspolitik der Kolonialregierung. Die Versammlung war friedlich, es gab keine bewaffneten Teilnehmer. Dennoch ließ der britische Brigadier-General Reginald Dyer ohne Vorwarnung das Feuer eröffnen. In rund zehn Minuten gaben seine Soldaten über 1.600 Schuss Munition auf die unbewaffnete Menge ab. Der Haupteingang wurde von Radpanzern versperrt, andere Ausgänge waren schmal oder führten in enge Gassen. Eine Flucht war kaum möglich. Hunderte Menschen starben, viele weitere wurden schwer verletzt.
Die genaue Zahl der Toten ist bis heute umstritten. Die offizielle britische Schätzung lag bei 379, indische Quellen gingen von über 1.000 aus. Eine detaillierte Auswertung durch die Historikerin Kim Ati Wagner auf Grundlage von Opferlisten, Augenzeugenberichten und Geländeanalyse kommt auf etwa 500 bis 600 Tote. Die Zahl der Verwundeten dürfte etwa drei Mal so hoch gewesen sein.
Politischer Kontext
Seit dem Ende des Ersten Weltkriegs herrschte in Indien politische Unruhe. Die britische Kolonialmacht hatte Reformen in Aussicht gestellt und zugleich unter dem Rowlatt Act von 1919 neue Notstandsmaßnahmen eingeführt. Diese erlaubten Inhaftierungen ohne Anklage sowie Einschränkungen der Pressefreiheit. Proteste gegen das Gesetz hatten sich in vielen Städten des Landes formiert.
Amritsar war ein Zentrum dieser Proteste. Zwei lokale Führer, Dr. Saifuddin Kitchlew und Dr. Satyapal, wurden kurz vor dem Massaker ohne Verfahren festgenommen. Die daraufhin ausbrechenden Unruhen am 10. April führten zu Ausschreitungen und zum Tod einiger europäischer Zivilisten. In der Folge verhängte die Kolonialregierung eine strenge Ausgangssperre. Es erfolgte jedoch keine systematische Kommunikation über Verbote oder Versammlungsauflagen, was später als schwerwiegendes Versäumnis eingestuft wurde.
Der für die Provinz politisch verantwortliche Lieutenant Governor Michael O’Dwyer unterstützte das Vorgehen Dyers und äußerte sich auch nach dem Massaker zustimmend zur Härte der Maßnahme. Er war in enger Abstimmung mit dem Militär vor Ort und galt als treibende Kraft hinter der repressiven Linie.
Die Entscheidung zu schießen

Brigadier-General Dyer war am Morgen des 13. April über eine geplante Menschenansammlung informiert worden. Er ließ einen Trupp von Gurkha- und Baluchi-Soldaten aufstellen und begab sich mit ihnen zum Jallianwala Bagh. Ohne Vorwarnung ließ er das Feuer auf die dicht gedrängte Menge eröffnen. Es wurde gezielt auf die Ausgänge geschossen, um die Flucht zu verhindern. Die Entscheidung fiel offenbar unter dem Eindruck einer unerwartet großen Versammlung, deren Ausmaß Dyer weder kannte noch kontrollieren konnte.
Auch die Zusammensetzung der Versammlung war nicht eindeutig. Ein angekündigter Redner distanzierte sich später von der Veranstaltung. Der Organisator Hans Raj blieb umstritten. Ihm wurde zeitweise eine Nähe zur britischen Polizei nachgesagt, doch gesicherte Belege fehlen. Die Polizei hatte sich aus dem Stadtgebiet zurückgezogen, Nachrichtengeber waren kaum aktiv, und der Einsatz von Aufklärungsflugzeugen war nicht durch Dyer koordiniert. Er verfügte über kaum verlässliche Informationen.

Dyers Rechtfertigung stützte sich auf das Prinzip „minimaler Gewalt“. Ziel sei nicht die Kontrolle eines Aufstands gewesen, sondern eine abschreckende Wirkung auf die Bevölkerung. Dieses Verständnis war innerhalb der britischen Kolonialpolitik verbreitet. Gewalt sollte begrenzt, aber wirksam sein. Der Begriff „minimum force“ wurde in verschiedenen Kontexten genutzt, blieb jedoch unscharf. Die Praxis orientierte sich weniger an rechtsstaatlichen Maßstäben als an der Einschätzung einzelner Offiziere vor Ort. Verbindliche Vorgaben für den Einsatz militärischer Mittel in kolonialen Konflikten fehlten. Dyer veranlasste nach dem Feuerbefehl keine medizinische Versorgung der Verletzten. Der abends verhängte Kurzbefehl verhinderte gezielte Hilfeleistungen. Ärzte wurden am Betreten des Geländes gehindert, manche erhielten direkte Anweisungen, keine Opfer zu behandeln. Die Toten und Verwundeten blieben über Nacht auf dem Gelände. Aus Angst vor Repression wagte kaum jemand, ihnen zu helfen.
In den Tagen nach dem Massaker erließ Dyer zusätzliche Strafmaßnahmen. Besonders umstritten war eine Anordnung, die Menschen zwang, auf allen Vieren durch eine Gasse zu kriechen, in der zuvor eine britische Frau angegriffen worden war. Die Demütigung verstärkte die Wut in der Bevölkerung.
Reaktionen in Indien
Die Nachricht von der Erschießung verbreitete sich rasch und führte landesweit zu Empörung. Mahatma Gandhi, der bis dahin einen gemäßigten Kurs vertreten hatte, radikalisierte seine Haltung gegenüber der Kolonialherrschaft. Der Vorfall stärkte den Zulauf zur indischen Nationalbewegung. Rabindranath Tagore, Literaturnobelpreisträger und Mitglied des kolonialen Ehrenordens, legte demonstrativ seinen Titel ab.
Ein symbolträchtiges Nachspiel ereignete sich 21 Jahre später: Am 13. März 1940 erschoss Udham Singh in London den früheren Punjab-Gouverneur Michael O’Dwyer. Vor Gericht erklärte Singh, er habe aus Rache gehandelt, weil O’Dwyer das Massaker veranlasst und verteidigt habe. Er wurde hingerichtet.
Das Massaker wurde zu einem zentralen Bezugspunkt für die Mobilisierung antikolonialer Bewegungen. Es zerstörte das Vertrauen in die Reformbereitschaft der britischen Administration und machte sichtbar, dass der Kolonialstaat bereit war, Gewalt gegen Zivilisten einzusetzen, um seine Kontrolle zu sichern.
Die britische Aufarbeitung
In Großbritannien wurde 1920 eine parlamentarische Untersuchung eingesetzt, die sogenannte Hunter-Kommission. Dyer verteidigte dort sein Vorgehen nicht nur, sondern sprach offen über seine Beweggründe:
Q: „What reason had you to suppose that if you had ordered the‘ assembly to leave the Bagh they would not have done so without the necessity of your firing, continued firing for a length of time?“
A: „Yes, I think it quite possible that I could have dispersed them perhaps even without firing.“Q: „Why did you not adopt that course?“
A: „I could disperse them for some time; then they would all come back and laugh at me, and I considered I would be making myself a fool.“1
Die Aussage unterstrich, dass es ihm nicht um Gefahrenabwehr ging, sondern um eine demonstrative Machtausübung. Die Kommission kritisierte das Vorgehen Dyers, vermied jedoch eine eindeutige Verurteilung. Dyer selbst wurde aus dem Dienst entlassen, erfuhr aber keine strafrechtlichen Konsequenzen. In konservativen Kreisen galt er als Verteidiger imperialer Disziplin. Eine Spendenaktion sammelte über 26.000 Pfund zu seinen Gunsten, getragen von über 50.000 Personen. Die Debatte über seine Person entwickelte sich zu einer nationalen Auseinandersetzung, in der sich unterschiedliche Deutungen britischer Selbstvergewisserung zeigten.
Auch kritische Stimmen wie Winston Churchill lehnten das Vorgehen nicht vollständig ab, sondern kritisierten vor allem dessen Ausmaß. Derek Sayer zufolge lag der Widerspruch nicht zwischen konservativen und liberalen Kräften, sondern innerhalb der liberalen Ordnung selbst. Das Massaker wurde nicht nur von imperialistischen Stimmen verteidigt, sondern auch durch ein Denken gerechtfertigt, das Ordnung als Voraussetzung von Fortschritt und Gewalt als deren mögliche Bedingung verstand. Rassistische Vorstellungen wirkten dabei stabilisierend. Sie unterstützten die Annahme, dass Gewalt gegen Kolonisierte unter bestimmten Umständen zulässig sei.
Nick Lloyd weist darauf hin, dass die Ereignisse von Amritsar keine tiefgreifende Reform der kolonialen Sicherheitspolitik auslösten. Die Gewaltpraxis blieb weitgehend unangetastet. Auch nach 1919 fehlten klare Richtlinien. Die strukturelle Spannung zwischen dem Anspruch auf rechtsstaatliche Kontrolle und der Realität imperialer Durchsetzungsmacht blieb bestehen.
Langzeitwirkung und Erinnerung
In Indien ist Amritsar bis heute ein Mahnmal kolonialer Gewalt. Der Ort des Massakers ist nationaler Gedenkort, das Ereignis Bestandteil des kollektiven Gedächtnisses. In Großbritannien hingegen blieb es lange marginalisiert und wurde erst in jüngerer Zeit stärker aufgearbeitet. Premierminister David Cameron besuchte 2013 das Gelände, sprach von einem tief beschämenden Ereignis, vermied jedoch eine offizielle Entschuldigung. Auch sein Nachfolger Rishi Sunak lehnte 2023 eine Entschuldigung ausdrücklich ab und verwies stattdessen auf die Bedeutung historischer Erinnerung.

Zum Weiterlesen
Links, die mit Sternchen (*) gekennzeichnet sind, führen auf die Seite von Amazon.de. Wenn Sie über diese Links bestellen, unterstützen Sie unsere Arbeit, ohne dass Ihnen Mehrkosten entstehen.
Nick Lloyd (2011): The Amritsar Massacre. The Untold Story of One Fateful Day.*
– Detaillierte Rekonstruktion des Ablaufs, basierend auf britischen und indischen Quellen. Zeigt Dyers Entscheidung als situativ, nicht als geplant.
Nick Lloyd: „The Amritsar Massacre and the Minimum Force Debate“, in: Small Wars & Insurgencies 21.2 (2010), S. 194–215.
– Analytischer Zugang zur kolonialen Sicherheitspolitik. Zeigt, wie Gewalt in imperialen Kontexten diskutiert und gerechtfertigt wurde.
Derek Sayer: „British Reaction to the Amritsar Massacre 1919–1920“, in: Past & Present 131 (1991), S. 130–164.
– Argumentiert, dass das Massaker nicht gegen, sondern im Rahmen liberaler Ordnung gedacht wurde. Betont die Rolle rassistischer Legitimationsmuster.
Kim A. Wagner (2019): Amritsar 1919. An Empire of Fear and the Making of a Massacre.* Systematische Auswertung indischer Opferlisten, Ortsanalysen und politischer Verantwortung. Klare Einordnung der Opferzahlen und der Rolle O’Dwyers.
Disorders Inquiry Committee (Hunter Report): Report of the Disorders Inquiry Committee, 1919–1920. Calcutta 1920.
– Offizieller Untersuchungsbericht zum Massaker, enthält Protokolle der Befragung Dyers. Dokumentiert die damalige britische Perspektive.
Bildnachweis
Titel: Jallianwala Bagh Gedenkstätte, 2022.
Alles eigene Aufnahmen
- Disorders Inquiry Committee 1919–1920 (Hunter Report), London 1920, S. 191.
Frage: „Welchen Grund hatten Sie zur Annahme, dass die Versammlung den Bagh nicht verlassen hätte, wenn Sie sie dazu aufgefordert hätten – ohne dass ein längeres Schießen notwendig gewesen wäre?“
Antwort: „Ja, ich denke, es wäre durchaus möglich gewesen, sie vielleicht sogar ohne Schüsse zu zerstreuen.“
Frage: „Warum haben Sie diesen Weg nicht gewählt?“
Antwort: „Ich hätte sie eine Zeit lang zerstreuen können. Dann wären sie alle zurückgekommen und hätten über mich gelacht, und ich hätte mich lächerlich gemacht.“, die Menge zu zerstreuen, ohne zu schießen. Aber ich hätte mich, so wie ich es sah, lächerlich gemacht.“ ↩︎


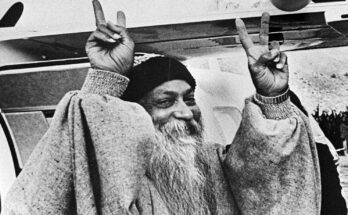

Ein Kommentar zu “Amritsar 1919 – General Dyer und die Praxis kolonialer Gewalt”