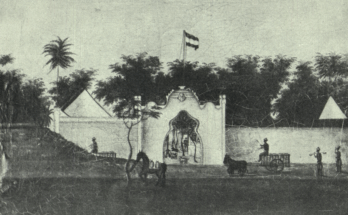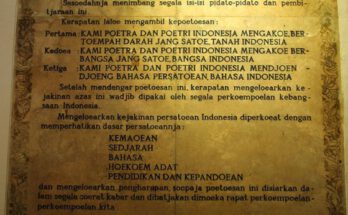Wer morgens durch Denpasar oder Ubud läuft, begegnet ihnen überall: winzige geflochtene Körbe, gefüllt mit bunten Blüten, die auf Gehwegen, vor Geschäften und an Tempeleingängen liegen. Was Touristen oft für Dekoration halten, ist tatsächlich eine der ältesten religiösen Praktiken Südostasiens – und ein faszinierender Blick in die Verflechtung von indischer Hochkultur und balinesischem Alltag.
Canang sari nennen die Balinesen diese kleinen Opfergaben. Der Name verrät bereits die komplexe Herkunft: „Canang“ stammt aus dem altjavanischen Kawi und bedeutet „Essenz mit Zweck“, während „sari“ direkt dem Sanskrit entstammt und „Kern“ oder „das Wesentliche“ bezeichnet. In diesen wenigen Worten spiegelt sich die jahrhundertelange Wanderung religiöser Ideen von Indien über Java nach Bali wider.
Von vedischen Feuern zu balinesischen Körben
Die Wurzeln der Opferpraxis reichen zurück in die vedische Zeit Indiens, etwa 1500 Jahre vor unserer Zeitrechnung. Damals opferten brahmanische Priester bereits Blumen, Nahrung und Räucherwerk an die Devas, die himmlischen Götter. Diese Traditionen verbreiteten sich mit hinduistischen Händlern und Gelehrten ab dem ersten Jahrhundert unserer Zeit über die Handelsrouten nach Südostasien.
Vermutlich besonders während der Blütezeit des Majapahit-Reiches auf Java, zwischen dem 13. und 15. Jahrhundert, gelangten diese Praktiken nach Bali. Doch die Balinesen machten daraus etwas völlig Eigenes: Während in Indien Opferzeremonien meist Priestern in Tempeln vorbehalten waren, wurde auf Bali jeder Hauseingang zum Altar, jede Familie zur Opfergemeinde.
Das System der vier Himmelsrichtungen
Die Struktur eines Canang sari folgt einem präzisen kosmischen Schema. Vier Farben werden in vier Himmelsrichtungen angeordnet: Weiße Blüten nach Osten für Shiva, rote nach Süden für Brahma, gelbe nach Westen für Mahadeva und blaue oder grüne nach Norden für Vishnu. Diese Farbsymbolik entstammt direkt der hinduistischen Kosmologie, wurde aber auf Bali um lokale Elemente erweitert.

Die strikte Farbzuordnung ist das ideale Grundprinzip, doch in der Praxis bestimmen die saisonale Verfügbarkeit der Blumen, der konkrete Anlass der Opfergabe und individuelle Gestaltung die endgültige Erscheinung. Diese Abweichungen sind kein Fehler, sondern Ausdruck einer lebendigen, anpassungsfähigen Tradition, bei der die aufrichtige Absicht der Darbietung im Vordergrund steht.
Das Körbchen selbst wird aus jungen Palmblättern geflochten. Diese Technik war vermutlich schon vor der hinduistischen Einflussnahme auf den Inseln bekannt. Hinzu kommen ein Stückchen Reis oder andere Nahrung sowie Räucherstäbchen. Die gesamte Opfergabe symbolisiert das balinesische Konzept von Tri Hita Karana: die Harmonie zwischen Göttern, Menschen und Natur.
Alltägliche Spiritualität
Was Canang sari von anderen religiösen Praktiken unterscheidet, ist die vollständige Integration in den Alltag. Zweimal täglich, meist morgens und abends, bereiten vorwiegend Frauen diese Opfergaben zu und verteilen sie im Haus, vor dem Geschäft oder am Arbeitsplatz. An Festtagen wie Galungan oder Kuningan können es mehrere Dutzend werden.
Diese Praxis hat einen bemerkenswerten Nebeneffekt: Sie demokratisiert die Religion. Während in vielen anderen hinduistischen Kulturen komplexe Rituale Priestern vorbehalten bleiben, kann auf Bali jede Familie direkt mit den Göttern kommunizieren. Das kleine geflochtene Körbchen wird zum Medium zwischen irdischer und göttlicher Welt.
Zwischen Himmel und Erde
Interessant ist auch, wohin die Opfergaben gelegt werden. Während die bunten Blüten für die Götter bestimmt sind, erhalten auch die Dämonen und Erdgeister ihren Anteil – direkt auf dem Boden. Diese duale Praxis spiegelt das balinesische Verständnis wider, dass sowohl positive als auch negative Kräfte anerkannt und besänftigt werden müssen.

Tradition in neuer Form bewahren
Die tägliche Herstellung und Darbringung von Canang sari strukturiert den Tagesablauf, verbindet die Familie mit ihren spirituellen Wurzeln und hält eine über tausendjährige Tradition lebendig. In einer sich schnell wandelnden Welt bleiben diese kleinen Körbe ein Anker zur Vergangenheit und ein Beispiel dafür, wie sich große religiöse Ideen in lokale Kulturen verwandeln und dort neue Bedeutungen entwickeln können.
Zum Weiterlesen:
Mit Stern (*) gekennzeichnete Empfehlungen sind Amazon-Partnerlinks. Wenn Sie über diese Links bestellen, unterstützen Sie unsere Arbeit, ohne dass Ihnen Mehrkosten entstehen.
Adrian Vickers: Bali: Ein Paradies wird erfunden – Historische Analyse der kulturellen Transformation Balis unter dem Einfluss von Hinduismus, Kolonialismus und Tourismus.*