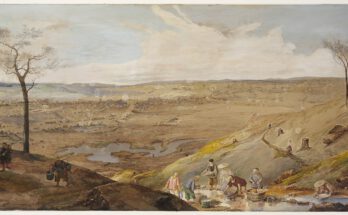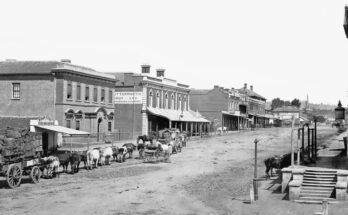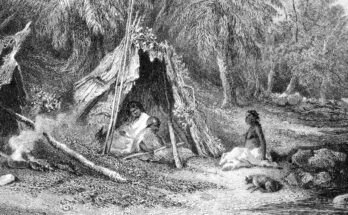Das Sydney Opera House prägt seit 1973 Australiens Selbstbild wie kein zweites Bauwerk. Die ikonischen Segel am Circular Quay verschmelzen Kultur, Hafenromantik und nationalen Stolz zu einem unverwechselbaren Symbol. Doch hinter dieser architektonischen Ikone der Moderne verbirgt sich eine turbulente Entstehungsgeschichte voller Finanzkrisen und politischer Machtkämpfe.
Vom Wettbewerb zum Auftrag
Als der Bundesstaat New South Wales im September 1956 einen offenen Wettbewerb auslobte, suchte er nach einem Mehrspartenhaus, das Oper, Konzert, Schauspiel und Ballett zugleich aufnehmen sollte. 233 Entwürfe trafen in Sydney ein. Die Jury rang mehrere Tage um eine Entscheidung, bis Juror Eero Saarinen verspätet eintraf, die Mappe des dänischen Architekten Jørn Utzon sah und bemerkte, hier liege „etwas von weltweiter Bedeutung“. Utzons Projekt erhielt am 29. Januar 1957 den Zuschlag. Die Jury betonte, die mutige Idee müsse technisch erst verifizierbar sein.
Formfindung: Von freien Skizzen zur Kugelgeometrie
Der Architekt stellte die drei Haupträume, einen großen Konzertsaal, eine Opernbühne und einen kleineren Mehrzwecksaal, auf ein weithin sichtbares Podium. Darüber legte er Schalen, die an Segel oder Muschelklappen erinnern, ohne diese direkt zu imitieren. Erst 1962 gelang dem Ingenieur Ove Arup der entscheidende Schritt: Sämtliche Schalensegmente konnten als Ausschnitte einer einzigen imaginären Kugel hergestellt werden. Mit dieser geometrischen Vereinheitlichung wurde eine serielle Fertigung der Betonrippen möglich. Dieser Meilenstein synchronisierte Planung und Ausführung.
Bauverlauf, Konflikte und die Kostenfrage
1957 belief sich der offizielle Kostenrahmen auf rund 7 Mio. AUD. Man kalkulierte mit einer Bauzeit von vier Jahren. Die Landesregierung beschloss, das Geld aus den Erlösen einer neu eingerichteten Staatslotterie zu decken, eine damals unkonventionelle, aber erfolgreiche Finanzierungsquelle.

Noch vor dem ersten Betonguss im März 1959 zeigte sich, dass Bodenanker und Podiumsfundamente aufwendiger werden würden als geplant. Parallel verfeinerte Utzons Büro die Dachform, was zusätzliche Prüfstatiken erforderte. Bis 1961 war die Kostenschätzung bereits auf 13 Mio. AUD gestiegen.
Mit dem Regierungswechsel von 1965 verlor Utzon seinen wichtigsten Fürsprecher, Premierminister Joseph Cahill. Die neue Führung drängte auf feste Termine und Budgets. Als sich herausstellte, dass die Bühnentechnik für den Opernsaal nicht unterzubringen war, forderte das Parlament eine grundlegende Umplanung. Am 28. Februar 1966 verließ Utzon, frustriert über gekürzte Honorarzahlungen und Eingriffe in seine Autonomie, die Baustelle. Ein Konsortium lokaler Architekten übernahm.
Das Nachfolgeteam konzentrierte sich darauf, die Schalen fertigzustellen und die Innenräume funktional einzurichten. Akustische Optimierungen und hochwertige Oberflächen traten zugunsten eines kontrollierbaren Zeitplans in den Hintergrund. Als Elisabeth II. das Haus am 20. Oktober 1973 eröffnete, lag die Endsumme bei 102 Mio. AUD, fast das Fünfzehnfache der Urkalkulation. Für jeden Einwohner von New South Wales entsprach dies damals etwa 30 AUD. Zugleich hatten die Lotterien die Baukasse um mehr als 60 Mio. AUD gefüllt.
Nutzung, Nachbesserungen und heutiger Betrieb

Sechs Säle bieten inzwischen Platz für jährlich rund 1 500 Vorstellungen. Während der Konzertsaal 2020 bis 2022 grundlegend akustisch saniert wurde, folgen weitere Etappen eines Modernisierungsprogramms, das bis 2030 reicht. Utzon selbst kehrte 1999 als Berater zurück und formulierte gemeinsam mit seinem Sohn Kim das „Sydney Opera House Design Principles“-Dokument, das alle Eingriffe an seinen Leitideen misst.
Welterbe und architekturgeschichtliche Einordnung
Seit 2007 steht das Opernhaus auf der UNESCO-Welterbeliste. Das Komitee würdigte die „kühne skulpturale Komposition“ ebenso wie die Pionierrolle, die das Projekt Ingenieuren und Architekten gleichermaßen abverlangte. Rückblickend markiert das Gebäude einen Endpunkt der analogen Statik und den Übergang zu global sichtbaren Kulturikonen des Spätmodernismus.

Zum Weiterlesen
Richard Weston: Utzon – Inspiration, Vision, Architecture. London 2002.
Anne Watson (Hg.): Building a Masterpiece: The Sydney Opera House. Sydney 2006.
Bildnachweis
Alles eigene Aufnahmen und public domain.